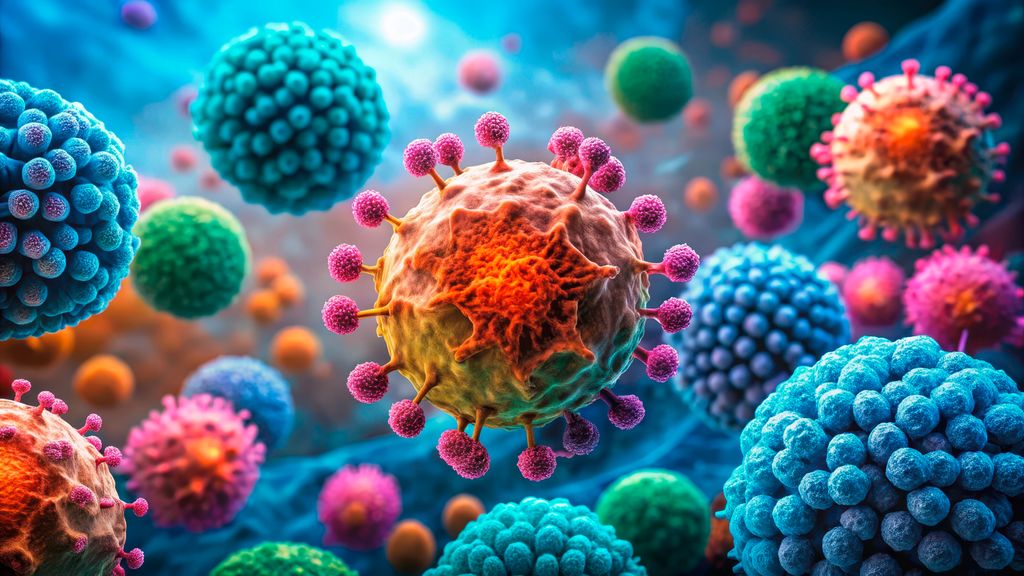
Praktisches Management bei kutanen Nebenwirkungen
Autor:innen:
Tanja Eicher
Dr. med. Lukas Krähenbühl
Kantonsspital Aarau AG
Dermatologie und Allergologie
E-Mail: tanja.eicher@ksa.ch
E-Mail: lukas.kraehenbuehl@ksa.ch
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Die Immuntherapie hat neue Hoffnung in die Krebsbehandlung gebracht – doch sie hat ihren Preis: Immer häufiger reagiert die Haut mit entzündlichen Veränderungen auf die Aktivierung des Immunsystems. Was oft als «milde Nebenwirkung» eingestuft wird, kann für Patient:innen zur starken Belastung werden.
Keypoints
-
Kutane irAE sind häufige Nebenwirkungen der Immuntherapie mit Checkpoint-Blockade und beeinträchtigen oft die Lebensqualität erheblich – auch wenn sie meist nur mild ausgeprägt sind.
-
Die Einteilung der Hautnebenwirkungen in die Schweregrade nach CTCAE ist massgebend für die Behandlung.
-
Ab CTCAE-Grad 2 ist die Zuweisung zur Dermatologie zur Mitbeurteilung empfohlen; bei CTCAE-Grad 3 ist die Überweisung dringlich zu stellen, mit dermatologischer Beurteilung am selben Tag.
Die Immuntherapie mit Checkpoint-Blockade hat die Behandlung von verschiedenen Krebsleiden in den letzten beiden Jahrzehnten massgeblich verändert, und die Anzahl behandelter Patient:innen steigt. Insbesondere kommen neue Indikationen bei anderen Tumorarten hinzu, zudem erfolgen adjuvante und neoadjuvante Behandlungen in früheren Stadien. Parallel nehmen durch den vermehrten Einsatz auch die immunvermittelten Nebenwirkungen («immune-related adverse events», irAE) zu. Potenziell kann sich durch die Hochregulierung des Immunsystems jedes Organ entzünden, wobei die Haut neben dem Gastrointestinaltrakt besonders häufig betroffen ist. Bei einer Behandlung mit PD-1/PD-L1-Blockade beträgt die Inzidenz von kutanen irAE 30–40%, noch häufiger (bis zu 50%) sind sie bei CTLA-4-Blockade.1 Bei Kombinationsbehandlungen addiert sich die Inzidenz nahezu.
Auch wenn die kutanen irAE meist nur mild ausgeprägt sind, stellen sie für die Patient:innen eine grosse Belastung dar und schränken die Lebensqualität stark ein.2 Der Schweregrad kutaner irAE wird nach «Common Terminology Criteria for Adverse Events»(CTCAE)-Kriterien eingeteilt. Auf der Haut orientiert sich diese Einteilung meist am Ausmass der beteiligten Körperoberfläche: So wird ein Anteil der Körperoberfläche von bis zu 10% als CTCAE-Grad 1 klassifiziert, ein Anteil von bis zu 30% als CTCAE-Grad 2 und ein Anteil von über 30% als mindestens CTCAE-Grad 3.3 Jedoch gibt es für jede einzelne kutane irAE jeweils eine separate und detailliertere Einteilung. Eine gute Übersicht bietet hierfür die Arbeit von Wang et al. von 2021.3 Die Einteilung in den entsprechenden CTCAE-Grad ist besonders wichtig, weil sich die Behandlung nach dem CTCAE-Grad richtet. Da die meisten Hautnebenwirkungen der Checkpoint-Blockade in der Regel mild (CTCAE-Grad 1–2) sind, ist eine Unterbrechung der Therapie meist nicht erforderlich. Eine frühzeitige Behandlung dieser Nebenwirkungen ist jedoch sehr wichtig. Dadurch lässt sich ein Fortschreiten der Symptome verhindern, die Fortsetzung der Checkpoint-Blockade-Therapie sichern und die Lebensqualität der Patient:innen verbessern. Während Hautnebenwirkungen vom CTCAE-Grad 1 normalerweise vom onkologischen Team behandelt werden können, empfiehlt sich eine Überweisung an die Dermatologie, vorzugsweise mit Erfahrung in supportiver Onkodermatologie, zur Mitbeurteilung und Mitbehandlung ab einem CTCAE-Grad 2. Bei CTCAE-Grad 3 wird indes eine dringliche Überweisung mit dermatologischer Beurteilung am selben Tag nahegelegt. Topische Kortikosteroide sind oft die erste Wahl bei der Behandlung von kutanen irAE; bei einigen Formen können aber auch weitere Massnahmen notwendig sein. Erst ab einem CTCAE-Grad 3 wird typischerweise eine Pause der Checkpoint-Blockade-Therapie erforderlich.3 Die Behandlungsmöglichkeiten einiger häufiger kutaner irAE beleuchten wir folgend genauer.
Pruritus auf scheinbar unveränderter Haut
Pruritus ist häufiges Begleitsymptom von kutanen irAE. Jedoch kann Pruritus auch isoliert auf unveränderter Haut vorkommen; dies bei bis zu 32% der Patient:innen. Damit gehört er zu den häufigsten irAE.4,5 Eine zentrale Rolle spielt bei der Behandlung (und auch Vorbeugung) die regelmässige Rückfettung, z.B. mit Polidocanol-haltigen Emollienzien. In Ausnahmefällen kann vorübergehend ein topisches Kortikosteroid angewendet werden. Systemisch können nichtsedierende Antihistaminika wie Bilastin oder Loratadin eingesetzt werden. Bei Persistenz unter diesen Massnahmen sollte ein Behandlungsversuch mit GABA-Analoga gestartet werden.1
Makulopapulöses Exanthem
Ebenfalls sehr häufig sind makulopapulöse Exantheme mit einer Inzidenz von bis zu 25%, insbesondere bei Anti-CTLA-4-Therapie oder Kombinationstherapie mit Anti-CTLA-4 und Anti-PD-1/PD-L1.6 Neben rückfettenden Massnahmen spielen (hoch)potente topische Kortikosteroide eine wichtige Rolle. Bei CTCAE-Grad 2–3 kann die topische Therapie mittels Tuchtherapie intensiviert werden und/oder eine orale Kortikosteroidtherapie mit 0,5–2mg pro kg Körpergewicht evaluiert werden. Bei begleitendem Juckreiz können Antihistaminika Linderung verschaffen.1 Insbesondere in refraktären Fällen könnte eine Behandlung mit Dupilumab eine raschere Wiederaufnahme der Immuntherapie ermöglichen.7
Lichenoides Exanthem
Abb. 1: Lichenoides Exanthem unter Pembrolizumab
Lichenoide Exantheme treten insbesondere unter Behandlung mit Anti-PD-1/PD-L1 bei bis zu 20% der Patient:innen auf, oft begleitet von Pruritus.3 Die klinische Präsentation kann einem Lichen ruber ähnlich sein, jedoch können die Läsionen auch hypertroph oder papulosquamös erscheinen8 (Abb.1). Bei CTCAE-Grad 1–2 sind (hoch)potente topische Kortikosteroide Therapie erster Wahl, ggf. ergänzt durch Antihistaminika. Bei hypertrophen Läsionen können intraläsionale Injektionen mit Triamcinolonacetonid in Betracht gezogen werden. Für CTCAE-Grad 3 und/oder Schleimhautbeteiligung werden orale Kortikosteroide mit 0,5–1mg/kg Körpergewicht eingesetzt. Alternativ als Zweitlinientherapie stehen die oralen Retinoide Alitretinoin oder Acitretin zur Verfügung.1
Psoriasiformes Exanthem
Insbesondere Patient:innen mit positiver Familienanamnese oder persönlicher Anamnese von Psoriasis haben ein erhöhtes Risiko für eine Checkpoint-Blockade-assoziierte Psoriasis.9 Am häufigsten ist der Subtyp der Plaque-Psoriasis, aber auch andere klinische Subtypen sind möglich10 (Abb.2). Die Therapie orientiert sich an den Behandlungs-Guidelines für Psoriasis vulgaris, wobei im Hinblick auf die Immuntherapie etwas niederschwelliger, aber weniger breit immunsupprimierende Ansätze gewählt werden. Topische Therapien mit Vitamin-D-Analoga und Kortikosteroiden werden bei CTCAE-Grad1 eingesetzt. Zusätzlich kann bei CTCAE-Grad 2 eine Schmalspektrum-UVB-Phototherapie oder eine Systemtherapie mit Acitretin oder Apremilast gestartet werden. Biologika (Anti-TNFα, Anti-IL-23, Anti-IL-17) werden ab CTCAE-Grad3 in Erwägung gezogen.1 Der Einsatz von Methotrexat soll aufgrund der relativ breiten Immunsuppression vermieden werden.
Abb. 2: Generalisierte Psoriasis guttata unter Nivolumab und Ipilimumab
Vitiligo-artige Depigmentierung
Vitiligo-ähnliche hypopigmentierte bis depigmentierte Maculae werden als irAE vor allem bei Melanompatient:innen beobachtet und sind bei dieser Gruppe mit verbessertem Therapieansprechen und verlängertem Gesamtüberleben assoziiert.11 Die Inzidenz liegt bei bis zu 25% der Patient:innen, die bei Melanom mit PD-1-Inhibtoren behandelt werden.12 Im Gegensatz zur klassischen Vitiligo treten die Depigmentierungen insbesondere an UV-exponierten Stellen auf, und ein Köbner-Phänomen kann nicht beobachtet werden.13 Primär ist ein Breitband-UV-Schutz wichtig. Das restliche Management ist ähnlich wie bei der Vitiligo: Camouflage, topische Kortikosteroide und/oder Calcineurin-Inhibitoren; ab CTCAE-Grad 2 ist ergänzend eine Schmalspektrum-UVB-Phototherapie möglich.1 Auf eine orale Therapie mit Kortikosteroiden ist auch bei schnellem Verlauf nach Möglichkeit zu verzichten, um die Wirkung der Immuntherapie nicht zu beeinträchtigen. Topische JAK-Inhibitoren (Ruxolitinib) können eingesetzt werden. Normalerweise persistieren die Vitiligo-artigen Veränderungen auch nach Beendigung der Checkpoint-Blockade-Therapie.8
Bullöses Pemphigoid
Ein Immuntherapie-assoziiertes bullöses Pemphigoid (irBP) tritt selten auf, vermehrt in Verbindung mit Anti-PD-1/PD-L1-Therapien, und stellt eine potenziell lebensbedrohliche kutane irAE dar.14 Im Gegensatz zum klassischen bullösen Pemphigoid kann beim irBP häufiger eine Schleimhautbeteiligung beobachtet werden.1 Höhergradige Ausprägungen sind ein häufiger Grund für eine Unterbrechung respektive Absetzung der Checkpoint-Blockade-Therapie,14 weshalb eine frühzeitige adäquate Behandlung der bullösen irAE zentral ist, um dies abzuwenden. Das therapeutische Management beinhaltet hochpotente topische Kortikosteroide für CTCAE-Grad 1 mit einer Applikation von 30–40g pro Tag. Für CTCAE-Grad 2 sollten zusätzliche orale Kortikosteroide (0,5mg Prednison pro kg Körpergewicht) evaluiert werden und die Therapie mit Checkpoint-Blockade sollte pausiert werden. Nach Verfügbarkeit sollte niederschwellig ein Therapieversuch mit Dupilumab unternommen werden, da aufgrund der gezielten Immunmodulation von einer geringeren Beeinträchtigung der Immuntherapie ausgegangen werden und diese – bei kontrollierter Nebenwirkung – rasch wieder aufgenommen werden kann.7 Kortikosteroid-sparende Medikamente wie Tetrazykline, Dapson und Omalizumab können ebenfalls in Betracht gezogen werden, wobei der Wirkungseintritt unter Umständen zu spät erfolgt. Als Rescue-Behandlung bei schwerem irBP (CTCAE-Grad 3) kann Methylprednisolon 1–2mg/kg Körpergewicht intravenös verabreicht werden und auch eine Therapie mit Rituximab kann in Betracht gezogen werden.1
Fazit
Zusammenfassend ist festzustellen, dass immunvermittelte Hautnebenwirkungen unter Immuncheckpoint-Blockade ein zunehmendes Problem sind. Sie beeinträchtigen die Lebensqualität von Patient:innen und gefährden erfolgreiche Krebsbehandlungen. Eine frühe, stadiengerechte Intervention ist in jedem Fall angezeigt.
Literatur:
1 Apalla Z et al.: European recommendations for management of immune checkpoint inhibitors-derived dermatologic adverse events. The EADV task force‚ dermatology for cancer patients’ position statement. J Eur Acad Dermatol Venereol 2022; 36(3): 332-50 2 Michot JM et al.: Immune-related adverse events with immune checkpoint blockade: a comprehensive review. Eur J Cancer 2016; 54: 139-48 3 Wang E et al.: Immune-related cutaneous adverse events due to checkpoint inhibitors. Ann Allergy Asthma Immunol 2021; 126(6): 613-22 4 Phillips GS et al.: Treatment outcomes of immune-related cutaneous adverse events. J Clin Oncol 2019; 37(30): 2746-58 5 Lacouture ME et al.: Immunologic profiling of immune-related cutaneous adverse events with checkpoint inhibitors reveals polarized actionable pathways. Clin Cancer Res 2024; 30(13): 2822-34 6 Tattersall IW, Leventhal JS: Cutaneous toxicities of immune checkpoint inhibitors: the role of the dermatologist. Yale J Biol Med 2020; 93(1): 123-32 7 Kuo AMS et al.: Management of immune-related cutaneous adverse events with dupilumab. J Immunother Cancer 2023; 11(6): e007324 8 Sibaud V: Dermatologic reactions to immune checkpoint inhibitors: skin toxicities and immunotherapy. Am J Clin Dermatol 2018; 19(3): 345-61 9 Voudouri D et al.: Anti-PD1/PDL1 induced psoriasis. Curr Probl Cancer 2017; 41(6): 407-12 10 Nikolaou V et al.: Immune checkpoint-mediated psoriasis: a multicenter european study of 115 patients from the European Network for Cutaneous Adverse Event to Oncologic Drugs (ENCADO) group. J Am Acad Dermatol 2021; 84(5): 1310-20 11 Teulings HE et al.: Vitiligo-like depigmentation in patients with stage III-IV melanoma receiving immunotherapy and its association with survival: a systematic review and meta-analysis. J Clin Oncol 2015; 33(7): 773-81 12 Hua C et al.: Association of vitiligo with tumor response in patients with metastatic melanoma treated with pembrolizumab. JAMA Dermatol 2016; 152(1): 45-51 13 Larsabal M et al.: Vitiligo-like lesions occurring in patients receiving anti-programmed cell death-1 therapies are clinically and biologically distinct from vitiligo. J Am Acad Dermatol 2017; 76(5): 863-70 14 Lopez AT et al.: A review of bullous pemphigoid associated with PD-1 and PD-L1 inhibitors. Int J Dermatol 2018; 57(6): 664-9
Das könnte Sie auch interessieren:
Klimaschutz und Dermatologie
Zu Beginn des 107. Kongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie (SGDV) in St. Gallen präsentierte ich einen kompakten Überblick zum Thema «Climate ...
Management und neue Therapieoptionen: ein Update
Mosaikwarzen gehören zu den besonders hartnäckigen Warzenformen und sprechen oft nur unzureichend auf Standardtherapien an. Innovative Verfahren wie die Mikrowellentherapie, ...
Der Nutzen und die Limiten der Therapie mit mesenchymalen Stammzellen
Neue Perspektiven in der Transplantationsmedizin, speziell in der «vascularized composite allotransplantation»: Aus Fettgewebe isolierte Stammzellen könnten einen bedeutenden Beitrag zur ...


