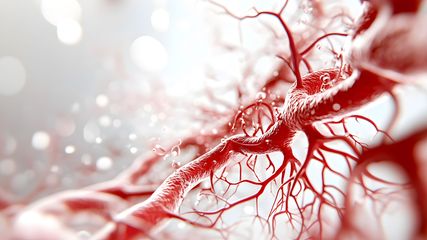Künstliche Intelligenz in der Neuroradiologie: Chancen, Herausforderungen und klinische Anwendungen
Autoren:
Prof. Dr. med. Roland Wiest1,2
PD Dr. med. Arsanay Hakim2
1 Departement für Digitale MedizinUniversität Bern
2 Universitätsinstitut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie
Universitätsspital Bern
E-Mail: Roland.Wiest@insel.ch
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Künstliche Intelligenz bietet vielfältige Chancen für die Neuroradiologie. Richtig eingesetzt, kann sie die Effizienz und Genauigkeit in der Radiologie verbessern. Doch es gibt zahlreiche Herausforderungen, die für eine langfristige Implementierung gemeistert werden müssen.
Seit über zwei Jahrzehnten befindet sich die medizinische Bildgebung in einem stetigen Wandel, getrieben durch technologische Innovationen und die zunehmende Digitalisierung. In der Neuroradiologie eröffnet insbesondere die künstliche Intelligenz (KI) neue Perspektiven für Diagnostik, Entscheidungsfindung und klinische Implementation. Radiologische Diagnostik basiert auf der in einer langen fachärztlichen Weiterbildung erlernten Fähigkeit, komplexe visuelle Informationen aus verschiedenen bildgebenden Modalitäten zu verarbeiten, einzuordnen, zu klassifizieren und medizinische Diagnosen zu stellen oder zu unterstützen. Trotz hervorragender Fachexpertise können in der Praxis Wahrnehmungsfehler auftreten. Hierzu gehören das Übersehen von Läsionen, insbesondere wenn chronische Erkrankungen zu multiplen und subtilen Hirnveränderungen geführt haben, des Weiteren Überinterpretationen oder bei Mehrfachbefundungen eine Ausrichtung an einem möglicherweise missinterpretierten Erstbefund («satisfaction of search»). Bei Schnittbildverfahren liegt die Fehlerquote zwischen 3 und 6%, in akademischen neuroradiologischen Zentren bei etwa 2%.1
Diagnostische Unterstützungssysteme («decision support systems», DSS) bieten die Möglichkeit, Entscheidungsfindungen zu objektivieren und Fehlerquellen zu reduzieren. Die klinische Integration von KI erfordert eine enge Verzahnung von Forschung, Technik und Praxis. Derzeit existieren mehr als 1000 klinische KI-Werkzeuge mit FDA- oder CE-Zertifizierung als Medizinprodukte, etwa 75% davon im Gebiet der Radiologie.2 Im Fachgebiet der Neuroradiologie können hierdurch drei Haupteinsatzbereiche abgedeckt werden.
Triagesysteme für medizinische Notfälle
Abb. 1: Axiales CT eines Patienten mit intrazerebraler Blutung in den linken Basalganglien. Das computergestützte Triagesystem markierte diesen Fall und kennzeichnete die vermutete Blutung. Die Bearbeitungszeit betrug etwa 2 Minuten
Diese Systeme kommen insbesondere in zeitkritischen Situationen und bei personalsensitiven Abläufen wie Nacht- oder Wochenenddiensten zum Einsatz. Triagesysteme analysieren die laufenden Untersuchungen und alarmieren, falls ein kritischer Befund vorliegt, den für die Untersuchung verantwortlichen Arzt, die verantwortliche Ärztin, indem die Untersuchung als Priorität markiert wird. In aussereuropäischen Ländern erfolgt eine Alarmierung, z.B. bei einem Schlaganfall, direkt auf ein mobiles Gerät (Smartphone) der Fachexpert:innen, die in die Behandlung eingebunden werden. In einer Cluster-randomisierten prospektiven Studie aus den USA, an der 243 Patient:innen aus vier Schlaganfallzentren in Texas beteiligt waren, konnte mittels KI-gestützter Analyse eines Gefässverschlusses die Zeit zwischen dem Eintreffen in der Klinik und dem Behandlungsbeginn von 100 (CI: 81–116) auf 88 Minuten (CI: 65–100) verkürzt werden.3 So können Triagesysteme z.B. Schlaganfälle oder Hirnblutungen (Abb.1) frühzeitig erkennen und priorisieren, wodurch wertvolle Zeit im Akutmanagement gewonnen wird. Studien zeigen, dass automatisierte Detektionssysteme für Gefässverschlüsse eine Sensitivitätvon ca. 90% und eine Spezifität von ca. 85% erreichen können. Insbesondere falsch negative Befunde treten dabei selten auf, da die Systeme darauf ausgerichtet sind, etwaige Unregelmässigkeiten anzuzeigen. Hierdurch treten allerdings häufiger falsch positive Befunde auf, die den positiven Vorhersagewert reduzieren können.4 Eine Metaanalyse, die die Sensitivität und Spezifität in der Detektion von Hirnblutungen untersuchte, erreichte eine Sensitivität und Spezifizität von jeweils 90%, kam jedoch nicht an die Genauigkeit von Radiolog:innen heran.5 Eine weitere Limitation der derzeit auf dem Markt befindlichen Systeme liegt allerdings darin, dass die Erkennung bestimmter Formen der Erkrankung limitiert ist, für die diese Methoden trainiert worden sind. So können Verschlussdetektoren zwar sehr gut proximale Gefässverschlüsse erfassen, sind jedoch nicht für die Erfassung mittlerer oder distaler thrombotischer Verschlüsse geeignet und dürfen in diesen Fällen nicht zur Beurteilung herangezogen werden. Bei bestimmten Arten von Blutungen im Gehirn oder in den umgebenden Räumen bestehen ebenfalls zum Teil erhebliche Unterschiede in der Treffsicherheit, weswegen eine abschliessende ärztliche Beurteilung des Befundes zwingend erforderlich ist.
Assistenzsysteme für die Bildanalyse
Assistenzsysteme unterstützen Radiolog:innen bei der Läsionsdetektion. Bei Patient:innen mit Multipler Sklerose (MS) können diese Systeme MS-Läsionen segmentieren, eine Volumenzunahme oder eine neu aufgetretene Läsion erkennen und diese in einem Bildfenster unterlegen. Der Abgleich mit den Magnetresonanzuntersuchungen ermöglicht es, einen «second review» mit der KI-basierten Analyse durchzuführen und z.B. gezielt nach neuen Signalveränderungen zu suchen (Abb. 2). Eine kürzlich durchgeführte Metaanalyse vom 23 Studien an 1252 Patienten und 1652 Kontrollen konnte eine gepoolte Sensitivität von 93% und eine Sensitivität von 95% zeigen.6 Trotz einer grossen Anzahl an durchgeführten Studien existieren bisher aber keine ausreichenden Daten zu Änderungen im Patient:innenmanagement oder zu sozioökonomischen Einflüssen.7 Die kürzlich vorgestellten revidierten McDonald-Kriterien, die neue Bildparameter wie zentrale Venenzeichen, paramagnetische Ringläsionen und intrakortikale Läsionen für die MS-Diagnose erlauben, erfordern zudem eine technische Überarbeitung existierender Algorithmen in Bezug auf diese Parameter.8
Abb. 2: Axiale FLAIR-Aufnahmen eines Patienten mit bekannter Multipler Sklerose: Ausgangsuntersuchung (links) und Verlaufsuntersuchung (Mitte) mit multiplen T2-hyperintensen Läsionen. Das computergestützte Läsionserkennungs-Tool markiert in der Verlaufsuntersuchung alte Läsionen in Blau und neu aufgetretene Läsionen in Rot (rechts)
Die automatisierte Erkennung inzidenteller Aneurysmen ermöglicht parallel zu den jeweiligen Workflows und Fragestellungen die gezielte Screening-Untersuchung auf Abnormalitäten der Gefässe. Die Früherkennung von zerebralen Aneurysmen ist entscheidend für die Verhinderung von Rupturen. Eine Metaanalyse, bei der sechs KI-Studien eingeschlossen wurden, in denen die KI unabhängig von Radiolog:innen operierte, ergab eine gepoolte Sensitivität von 91,2% bei 16,5% falsch positiven Befunden, während KI-unterstützte Radiolog:innen eine gepoolte Sensitivität von 90,3% bei 7,9% falsch positiven Befunden erreichten.9
Quantitative Biomarker
Automatisierte morphometrische Analysen unterstützen die bildgebende Quantifizierung von regionalen Parenchymveränderungen und können als Surrogatmarker bei Patient:innen mit kognitiven Störungen zur Mustererkennung spezifischer Demenzformen dienen. So lässt sich beispielsweise eine Hippocampusatrophie bei kognitiven Störungen zuverlässig quantifizieren. Eine kürzlich durchgeführte Studie zur Beurteilung einer hippokampalen Atrophie mittels «deep learning»-basierter radiomischer Parameter bei Patient:innen mit Epilepsien zeigte eine verbesserte Präzision in der Bildinterpretation durch Neuroradiolog:innen und Neurolog:innen in knapp 10% der untersuchten Fälle, falls eine automatisierte Bildanalyse beigezogen wurde.10
Datenqualität, Bias und Modellentwicklung
Eine zentrale Herausforderung in der KI-gestützten Neuroradiologie liegt in der Qualität der jeweiligen Bilddaten, welche zur Bildanalyse verwendet werden. Bildparameter, unterschiedliche Hardware der Scanner und standortspezifische Protokolle beeinflussen sowohl die Trainings- und Testdaten wie auch die Anwendung an Geräten in der Praxis. Da bereits kleine Abweichungen die Genauigkeit eines Modells beeinträchtigen können, ist es entscheidend, Strategien zur Risikominimierung und Biaskontrolle zu implementieren.11 Multizentrische Analysen zeigen deutlich, dass Scanner- und Standortfaktoren berücksichtigt werden müssen, um robuste und generalisierbare Modelle zu entwickeln.
Monitoring von KI in der klinischen Praxis
Für den nachhaltigen Einsatz von KI im klinischen Alltag genügt es nicht, einzelne Pilotprojekte erfolgreich durchzuführen. Vielmehr braucht es ein systematisches Monitoring, eine kontinuierliche Evaluierung und eine Strategie zur Implementierung.
Zu den Schlüsselelementen zählen:
-
Post-Deployment-Monitoring: Überwachung von Daten-Drift und Modellleistung im laufenden Betrieb
-
Evidenzgenerierung: Vergleich von KI-gestützten Befunden mit klinischem Outcome
-
Governance und Qualitätssicherung: regelmässige Anpassung der Systeme an neue technische und medizinische Anforderungen
Fazit
Die Neuroradiologie steht an der Schwelle zu einer neuen Ära. KI-Systeme sind keine abstrakten Zukunftsvisionen mehr, sondern bereits heute klinisch nutzbare Werkzeuge. Sie erhöhen die diagnostische Genauigkeit, beschleunigen im Idealfall Prozesse und eröffnen neue Möglichkeiten der personalisierten Medizin. Damit diese Potenziale voll ausgeschöpft werden können, braucht es jedoch klare Strategien für Implementierung, Qualitätssicherung, Risikomanagement und Ausbildung. Der Schlüssel liegt in der Kombination aus technischer Innovation, klinischer Expertise und verantwortungsvollem Umgang mit den neuen Technologien. Diese Technologien werden nicht, wie häufig zu hören, den Beruf der Radiolog:innen und Neuroradiolog:innen überflüssig machen, sie werden aber die Berufsbilder und Arbeitsprozesse nachhaltig verändern. Hierfür benötigt es in Zukunft adäquate Verrechnungsmodelle, die über die bisherigen Definitionen ärztlicher und technischer Leistungen hinausgehen und Innovationen im Gesundheitswesen gezielt fördern, wie dies z.B. in transatlantischen Gesundheitssystemen bereits der Fall ist.
Literatur:
1 Babiarz LS et al.: Quality control in neuroradiology: discrepancies in image interpretation among academic neuroradiologists. AJNR Am J Neuroradiol 2012; 33(1): 37-42 2 Singh R et al.: How AI is used in FDA-authorized medical devices: a taxonomy across 1,016 authorizations. NPJ Digit Med 2025; 8(1): 388 3 Martinez-Gutierrez JC et al.: Automated large vessel occlusion detection software and thrombectomy treatment times: a cluster randomized clinical trial. JAMA Neurol 2023; 80(11): 1182-90 4 Schlossman J et al.: Head-to-head comparison of commercial artificial intelligence solutions for detection of large vessel occlusion at a comprehensive stroke center. Front Neurol 2022; 13: 1026609 5 Agarwal S et al.: Systematic review of artificial intelligence for abnormality detection in high-volume neuroimaging and subgroup meta-analysis for intracranial hemorrhage detection. Clin Neuroradiol 2023; 33(4): 943-56 6 Darrudi R et al.: Artificial intelligence in the diagnosis of multiple sclerosis using brain imaging modalities: a systematic review and meta-analysis of algorithms. Medicine (Baltimore) 2025; 104(38): e44493 7 Spagnolo F et al.: How far MS lesion detection and segmentation are integrated into the clinical workflow? A systematic review. Neuroimage Clin 2023; 39: 103491 8 Montalban X et al.: Diagnosis of multiple sclerosis: 2024 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2025; 24(10): 850-65 9 Din M et al.: Detection of cerebral aneurysms using artificial intelligence: a systematic review and meta-analysis. J Neurointerv Surg 2023; 15(3): 262-71 10 Rebsamen M et al.: Clinical evaluation of a quantitative imaging biomarker supporting radiological assessment of hippocampal sclerosis. Clin Neuroradiol 2023; 33(4): 1045-53 11 Rebsamen M et al.: Growing importance of brain morphometry analysis in the clinical routine: the hidden impact of MR sequence parameters. J Neuroradiol 2024; 51(1): 5-9
Das könnte Sie auch interessieren:
Susanne Wegener: Reperfusionsversagen betrifft nicht nur Schlaganfall
Prof. Dr. med. Susanne Wegener ist leitende Ärztin an der Klinik für Neurologie des Universitätsspitals Zürich. Neben ihrer klinischen Arbeit ist sie stark in der Forschung tätig. Einer ...
Akut symptomatische Anfälle – sind sie alle gleich?
Epileptische Anfälle treten bei allen Personen mit Epilepsie auf, aber umgekehrt leidet nicht jede Person, bei der ein epileptischer Anfall auftritt, an Epilepsie. Tatsächlich handelt es ...
Hypersomnolenz im Fokus
5–10% der Allgemeinbevölkerung sind von Wachstörungen betroffen. Diese haben ein breites Spektrum und umfassen häufige Störungen wie Müdigkeit, Fatigue oder Aufmerksamkeitsstörungen. ...